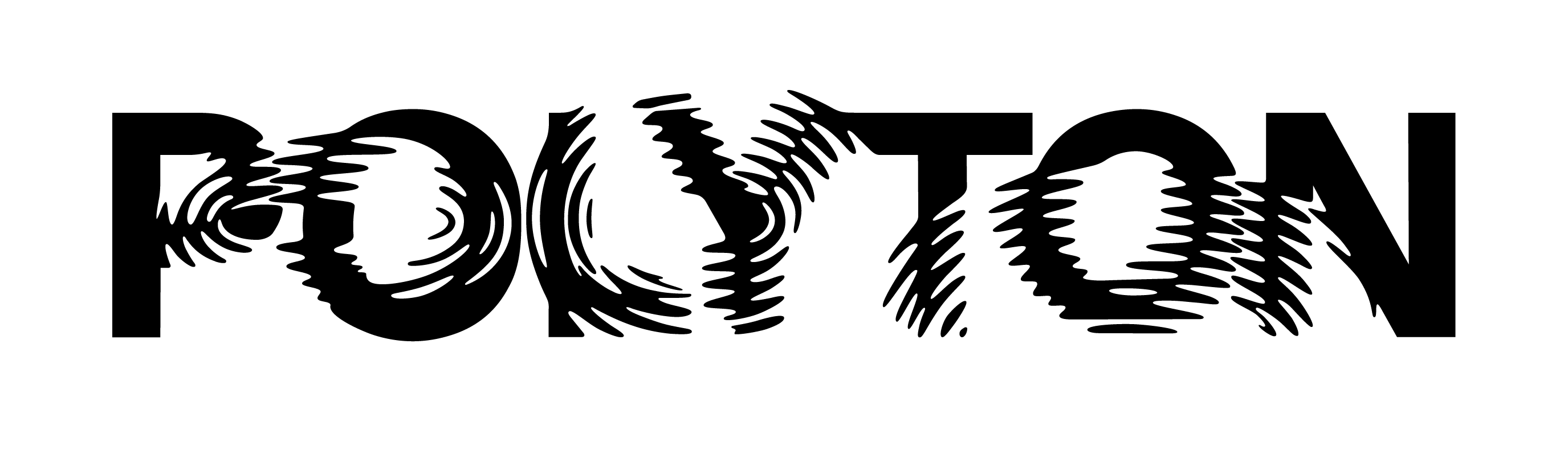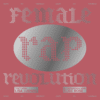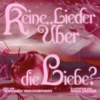Vier Jahre dauerte es, bis ich den Song von Alanis Morissette Wirklichkeit werden ließ. Wir saßen im Kino der Hackeschen Höfe und guckten „Requiem for a Dream“ in einer der hinteren Reihen. Es war voll, aber nicht überfüllt und ich fummelte n seinem Schritt herum. Alle verfolgten gebannt, wie die beiden Protagonist:innen immer weiter verwahrlosten, und ich rutschte so unauffällig wie möglich von meinem Sitz und machte es mir auf den Knien gemütlich. Der Rest muss nicht erklärt werden. Als ich den Song „You Oughta Know“ zum ersten Mal hörte, war ich 14 Jahre alt. Das ganze Album Jagged Little Pill war zu meiner Bibel geworden, durch die ich das schlechte Schul-Englisch auf ein Niveau katapultierte, das selbst meinen sehr gut Englisch sprechenden Vater zum Stutzen brachte.
Ich kannte Wörter, die sonst niemand kannte, einfach, weil ich jede einzelne Songzeile mithilfe des Wörterbuchs übersetzte. Genau: Wörterbuch. So ein echtes physisches Wörterbuch. Einfach, weil es 1995 noch kein Google gab, geschweige denn eine Form des Internets, die es mir ermöglichte, Alanis’ Lyrics einfach automatisch übersetzen zu lassen. Es gab zwar einen Computer in unserer Wohnung, auf dem ich bis dahin „Prince of Persia“ gespielt hatte, aber ohne Zugang zum World Wide Web. Während sich meine Eltern zum Thema Sex ausschwiegen, lernte ich damals alles von Alanis und auch ein bisschen von der Zeitschrift Bravo.
Mittlerweile habe ich selbst eine Tochter. Sie ist achteinhalb Jahre alt und riesiger Pop-Fan. Aktuell hört sie Tate McRae rauf und runter. Ich überraschte sie vor ein paar Monaten mit einem Konzertbesuch und wurde an meine eigene Jugend erinnert. So viel Sex fand da auf der Bühne und in den Texten statt. Zwar wird bei uns zuhause offen über menschliche Sexualität gesprochen, aber es ist mehr als klar, dass auch Tates Songtexte einen bleibenden Eindruck bei meinem Kind hinterlassen werden.
Denn Pop ist voll mit Sex. Heute genauso wie früher. Zum Beispiel „Short Dick Man“ von 20 Fingers – der Song erschien 1994 und ich hörte ihn damals als 13-Jährige rauf und runter. Ob es meinen Männergeschmack und meinen Blick auf das andere Geschlecht beeinflusst hat? Selbstverständlich. Musik ist identitätsstiftend. Neben der sexuellen Aufklärung versorgt sie Zuhörer:innen mit Behauptungen, die durch die emotionale Vermittlung zu Wahrheiten stilisiert werden können. Das muss nicht nur negativ sein, wie viele glauben, die sich harte Rap-Texte anhören, sondern fördert auch emanzipatorische Entwicklungen. Meine feministische Erziehung haben Salt’n’Pepa, TLC, Alanis Morissette und die Spice Girls übernommen. Ohne sie hätte ich mich wohl nicht so leicht als begehrendes Subjekt erleben können.
Auch wenn mein Upbringing nicht gerade prüde war, so war es nicht durch eine moderne Vorstellung von weiblicher Lust geprägt. Was die philosophischen Texte, die ich schon als Teenager inhalierte, nicht schafften, brachten die Popsongs zu einem erfolgreichen Ende: Ich bin als Frau ein sexuelles Subjekt, mit einem individuellen
Begehren und einem eigenen Blick auf mich und das andere Geschlecht. Während heute viel über Male Gaze geschrieben wird, Frauen infantilisiert und zu reaktiven Körpern umgedeutet werden, die auf kein eigenes schmutziges Repertoire
zurückgreifen können, hieß es damals „Go for it Gurl“. Frauen wurden in ihrem freien
sexuellen Ausdruck und Begehren musikalisch unterstützt. Natürlich gab es parallel
dazu eine gegenläufige Bewegung. So wie es immer ist. Weil Wahrheit nur über das
Aushalten von Widersprüchen gefunden werden kann.
Die Gegenbewegung, von der ich spreche, war und ist Rap, der nicht gerade bekannt ist für seine progressiven Inhalte. Rap ist voll mit krassem Scheiß: Frauenverachtung, Männerverachtung, Drogen, Mord, Kriminalität. Wie ein irrer Thriller, eine Serienkiller-Documentary. Was verboten ist, gehört in den Rap. Der Plan: Das gewalttätige Potenzial, das in uns allen steckt, aber dessen Ausleben uns aufgrund von Sozialisation untersagt ist, durch den filmischen oder musikalischen Transfer erfahrbar zu machen. Wir schauen und hören gerne extrem negativ konnotierten Ereignissen zu, weil wir so – in der sicheren Rolle des Zuschauenden oder Zuhörenden – dennoch Teil einer kriminellen, gewalttätigen, blutränstigen oder eben allgemein verbotenen Tat werden können. Wir singen mit und werden selbst zum:zur Täter:in. Der Druck der nicht ausgelebten und verbotenen Impulse wird dabei kanalisiert.
Also alles halb so wild. Was der Mensch tut, singt und behauptet, steckt eben in ihm. Das kann man irre finden, aber eigentlich ist es purer Realismus. Ich habe kein christliches Menschenbild, sondern eines, das auf Pragmatismus fußt. Ich glaube nicht an ein Paradies oder daran, dass der Mensch nur gut sein könnte. In uns allen stecken verbrecherische Anlagen. Manche können sich diese Tatsache eingestehen, andere müssen ihre negativen Eigenschaften obsessiv auf andere projizieren. So gesehen ist Musik nichts weiter als ein Spiegelbild, genau wie es Filme, Medien und Politik sind. So, wie es Social Media ist. Wenn uns das Unbehagen bereitet, was wir sehen, hören oder erfahren, dann bereitet uns das Menschsein Unbehagen.
Das gilt auch für den Augenblick als Cardi Bs Song „WAP“ 2020 veröffentlicht wurde. Meine Tochter war damals fünf Jahre alt und wippte zum Beat im Auto mit, als wir uns auf dem Weg zu Freund:innen befanden. Grillparty im Garten. Vor „WAP“ gab es kein Entrinnen. Wohin man kam, lief der Song, so auch dort. Wir Erwachsenen legten das Grillfleisch fein säuberlich auf das Metall, während die 14-jährige Tochter meiner Freund:innen ordentlich aufdrehte, als der Song aus den Boxen erklang. Am Pool
tanzte sie dazu. Mit allem, was man aus dem Video kennt. Meine tanzbegeisterte
Tochter lief zu ihr und machte mit. Das muss man dem Song lassen. Der Sound
lullt einen hypnotisch ein. Wir standen da wie gebannt am Grill. Der Dampf stieg
in die Luft. Cardi forderte:
„I want you to park that big Mack truck right in this little garage. Make it cream, make me scream. Out in public, make a scene.”
Wir wurden ein bisschen rot, ein bisschen wollten wir aber auch mitsingen. Man konnte der Sexualität nicht entkommen, die mit einem Mal den gesamten Raum einnahm. Was sonst Tabu wäre, wurde zum Teppich, der den Boden der Realität bedeckte. Und wir waren anwesend, mussten das aushalten, wollten sofort verschwinden, fanden es gut und nicht gut zugleich. Wir sahen dabei zu, wie unsere Kinder den Song als Song ohne Inhalt wahrnahmen, während wir den Song ohne und mit Inhalt wahrnahmen. Die Anspannung, die unter allen Anwesenden entstand, war fantastisch, wenn man Sozialexperimente mag. Scham, Lust, Beklemmung, Irritation – das alles wurde in uns ausgelöst. Durch diesen Song und die Konfrontation damit, dass er in einer Gruppe ertönte. Es war, als würde man gemeinsam gezwungen, einen Porno zu schauen. Das kann man zu viel finden.
Ich fand es gerade richtig.
Aber ich gucke auch gerne Love is Blind, Love Island und Temptation Island, allerdings in der englischsprachigen Version. Als Homo sapiens sind wir Voy- eur:innen. Wir schauen dem Sex, Begehren und der Verführung der anderen in Reality Formaten und fiktionalen Sendungen zu. Deshalb gibt es Aufzeichnungen über Pornografie oder erotische Geschichten bereits seit der Antike. Sex gibt es in der Realität und in der Fiktion der Künste. Vielleicht ist er bei den meisten nicht so wild wie in den Songs und Filmen, die wir hören und schauen, aber es ist eine kreative Form, Fantasien vor deren Auslebung wir uns fürchten, sicher als Trans- ferleistung erfahren zu können. Das bewahrt uns nicht davor, Kinder und Jugendliche zumindest ein bisschen zu begleiten. Und wenn ich sage, ein bisschen, dann meine ich das auch so. Alanis’ „You Oughta Know“ hat mir sexuell absolut nichts angetan. Hätte meine Mutter mir nach dem Hören des Songs plötzlich verboten, ihn jemals wieder anzumachen, wäre meine Entwicklung wirklich geschädigt worden.
Ich bin kein Fan davon zu tabuisieren.
„Alles darf, nichts muss“ – das alte Swin- ger:innen-Motto gilt auch in diesem Fall. Deswegen schränke ich das musikalische Repertoire, auf das meine Tochter durch ihren eigenen Spotify-Account zugreifen kann, nicht ein. Soll sie doch hören, was Tate da so findet und wie er meint, dass Männer gesehen und behandelt werden sollten. Wenn meine Tochter bei einem Song mitsingt und ich eine Strophe oder Aussage zu eindimensional finde, dann korrigiere ich an dieser Stelle, indem ich Möglichkeitsräume eröffne: „Joah, so ist das ja nicht immer“ oder „Es gibt darauf auch andere Perspektiven“ und so weiter. Weniger Einschränkung, mehr Zugang zu den Komplexitäten, die unser menschliches Leben ausmachen. Dann kann auch ununterbrochen über Sex gesungen werden.
Das meiste, was wir hören oder sehen, dient nicht als allgemeingültige Wahrheit. Das gilt für alle Lebensbereiche. Ziel sollte es sein, uns selbst aber auch unsere Kinder aktiv und reflektierend zu begleiten. So kann man die Musik genießen, die Entspannung erleben, die notwendigerweise gebraucht wird, und glaubt dennoch dem Gesungenen nicht vorbehaltlos.