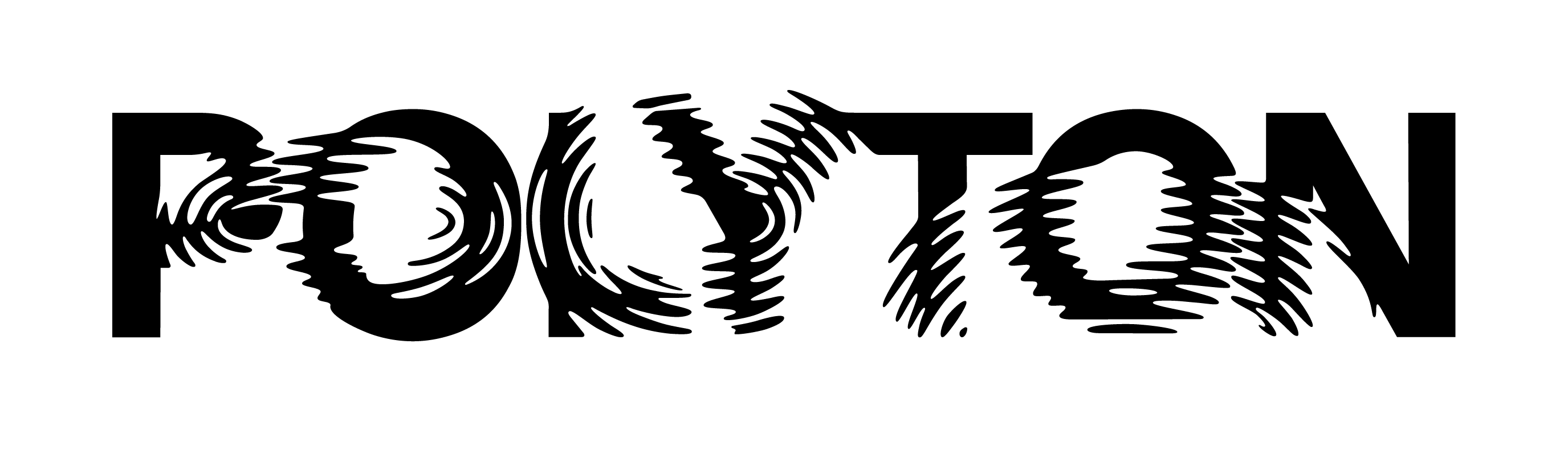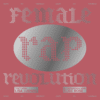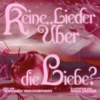Beyonce kann nicht singen. Woher ich das weiß? Natürlich aus der Fachpresse: In der 354. Ausgabe des deutschen Rolling Stone (April 2024) erklärt Jochen Distelmeyer in seinem Text „Pferde auf der Wiese“, dass Beyoncé „knödelnde Koloraturschlenker“ nutzt, um ihr „Nichtsingenkönnen“ zu verschleiern.
Gut, Beyoncé hat im Pop neue Standards gesetzt, Live-Shows revolutioniert, Grammy-Rekorde gebrochen. Es gibt unzählige Live-Auftritte von ihr, in denen sie mühelos jeden Ton trifft. Aber singen – singen kann sie nicht, sagt Jochen. Naja, oder: Jochen Distelmeyer gefällt einfach nicht, WIE Beyoncé singt. Das wäre ja grundsätzlich okay, soll er sich halt andere Sachen anhören (Christina Aguilera würde ich nicht empfehlen, sonst wirft er ihr in seinem nächsten Text noch eben jenes Knödeln vor). Aber vom persönlichen Geschmack direkt auf generelles Unvermögen zu schließen, ist (musik-) journalistisch unsauber.
Der Rolling Stone Deutschland hat auch noch andere Erkenntnisse auf Lager: Taylor Swift etwa ist so, wie sie ist, nicht richtig. Konstruktive Änderungsvorschläge gibt’s direkt: Sie solle doch bitte lieber eine „toll gealterte Frau, [...] ein richtiger weiblicher Zausel“ sein, steht in einer Konzertkritik von Musikerin Charlotte Brandi zum Auftritt in Swift-, äh, Gelsenkirchen. Charlotte Brandi schreibt in ihrem Artikel „Liebe Swifties, jetzt helft mir doch mal. Was genau ist es? Warum sie?“ ziemlich viele Zeilen darüber, dass sie a) statt auf einem Taylor-Swift-Konzert lieber woanders wäre, nämlich bei erwähntem weiblichen Zausel und b) nichts an Taylor Swifts Konzert gut findet. Weder Instrumente noch Bühnenbild oder Hüftschwung. Sie beteuert, sie habe das Konzert wirklich mögen wollen, bleibt aber trotzdem nicht bis zum Ende, sie sei eben – Überraschung! – „nicht mehr 12 Jahre alt“. Die Prämisse: Die Autorin gehört nicht zur Zielgruppe und kann deshalb weder mit der Musik noch mit Taylor Swifts Show was anfangen.
Claire Beermann ist schon deutlich länger genervt von Taylor Swift. Im Mai schreibt sie in einem Artikel für ZEIT Online unter dem Titel „Die schon wieder“ darüber, dass es langsam reiche mit der Dauerpräsenz: „Taylor Swift scheißt uns – sorry! – so zu mit ihrer Musik und ihrem Supersein, dass sich manch einer nach einer Pause sehnt.“ Dass die Autorin durch ihren Text ebenfalls die kritisierte Präsenz der Musikerin erhöht, scheint aber okay zu sein. Im April schrieb Claire Beermann übrigens einen Artikel über Lenny Kravitz, der permanent und besonders auf Social Media seinen gestählten Körper zeigt. Darin lobte sie ihn dafür, dass er eben nicht auf Bescheidenheit setze: „Ich finde, wir brauchen mehr Angeber.“ Zur Verteidigung von Jochen Distelmeyer und Charlotte Brandi könnte man einwerfen, dass weder er noch sie (Musik-)Journalist:innen sind. Allerdings gab es in beiden Fällen eine professionelle Redaktion, die die Artikel in Auftrag gegeben, redigiert und veröffentlicht hat. Und die offenbar dahintersteht.
Was sollen solche Texte also? Hauptsächlich eine ältere Leserschaft glücklich machen, bei der man davon ausgeht, dass sie immer noch dem Irrtum aufsitzt, nur sogenannte handgemachte Gitarrenmusik sei richtige Musik, und alles andere, vor allem rosafarbener Bubblegum-Pop, verdiene sowieso keine ernste Auseinandersetzung? Geht es um Klicks? Bei ZEIT Online wird es vermutlich genau das sein, und ich bin mir sicher, dass es funktioniert hat. Vielleicht sind die ausgewählten Texte drei besonders absurde Beispiele, in denen sich mit Musikkünstlerinnen auseinandergesetzt wird. Ich habe sie gewählt, weil sie zwar extrem aber auch symptomatisch sind. Nämlich dafür, wie mit Frauen in der Branche umgegangen wird und was das für unseren Alltag bedeutet.
Männern wird in der Musikpresse eine andere Art der Aufmerksamkeit zuteil: Bob Dylan ist eine lebende Legende, keine Frage. Der beste Sänger ist er aber nicht, auch wenn seine Stimme Charakter hat, das ist allgemein bekannt. Dennoch würde, vor allem beim Rolling Stone, niemals jemand auf die Idee kommen, seine Leistung deshalb in Frage zu stellen. Bob Dylans reales Defizit wird also akzeptiert, vielleicht sogar als genial ausgewiesen. Beyoncé hingegen wird ein nicht vorhandenes Defizit angedichtet, um ihre Leistung in Frage zu stellen. Vergleiche ich hier tatsächlich Dylan und Beyoncé und ist das jetzt Blasphemie? OMG! Zur Beruhigung ein Vergleich, den man allgemein für angemessener halten dürfte: In wie vielen Kritiken zu Harry Styles Konzerten wird darüber nachgedacht, dass Harry Styles einfach viel zu wenig Neil Diamond ist? In keiner? Liegt vielleicht daran, dass es wenig Sinn ergibt, diesen Gedanken zu verfolgen.
Ich frage mich bei allen Ich-Texten über Taylor-Swift-Konzerte sowieso: Warum ist es ein gängiges Narrativ, sich erstmal persönlich von Taylor Swifts Musik zu distanzieren? So passiert auch bei Spiegel Online, wo Kolumnistin Tara-Louise Wittwer einen zwar sehr netten, anrührenden Artikel über Swifties und ihren Zusammenhalt geschrieben, aber eben auch erstmal klargemacht hat: Sie selbst könne mit der Musik nichts anfangen. Ist es nicht die Aufgabe, bei Konzert- besprechungen journalistische Distanz zu wahren, um die Szene, Atmosphäre und diejenigen, für die das alles bestimmt ist, zu beobachten und einzufangen? Oder wie es Jens Balzer, Musikjournalist und Autor, im Gespräch für diesen Text formuliert: „Ich habe mal über ein Andrea-Berg-Konzert geschrieben und der schönste Moment war, als die älteren Frauen mit ein paar queeren Leuten, die nach dem CSD zum Konzert kamen, zusammen Piccolo getrunken und getanzt haben. Andrea Berg hat da Welten zusammengebracht, die sonst selten miteinander zu tun haben.“ Dass Jens Balzer in seiner Freizeit niemals eine Andrea-Berg-Platte hören würde, tut nichts zu Sache.
Liegt das ewige Distanzieren von Taylor Swifts Musik daran, dass sie hauptsächlich junge Frauen anspricht? Dass sie deren Lebenswelten erklärt und dass diejenigen, die in Redaktionen sitzen, partout nicht wissen, wie sie sich dem Gegenstand nähern können? Sind sie nicht bereit, bei einem Phänomen für vor allem junge Frauen denselben Transfer, dieselbe journalistische Leistung zu erbringen wie bei Künstler:innen, die sie persönlich für wertvoller halten?
Man könnte aktuell den Eindruck bekommen, wir würden tatsächlich, wie etwa The New Yorker im Juli schrieb, den Sommer des Girly Pop erleben. Oder überhaupt das Jahr, in dem Frauen das Pop-Business anführen. Wohin man 103 schaut, überall erfolgreiche Musikerinnen – Charli xcx, Dua Lipa, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Camila Cabello, Cardi B, Rosalía, Doja Cat, Billie Eilish und eben Beyoncé und Taylor Swift. Die Liste ist unvollständig und könnte ewig weitergeführt werden.
„Im Spiegel stand schon 2010, dass der Pop jetzt von den Frauen übernommen wird,“ erzählt Sonja Eismann am Telefon und bezieht sich auf einen Artikel von Tobias Rapp über Musikerin M.I.A. Sonja Eismann ist Dozentin, Kulturjournalistin und eine der Gründerinnen des Missy Magazine. „Damals, 2010, und heute trügt der Schein der weiblichen Pop-Herrschaft“, sagt sie. Denn es zähle nicht nur, was auf den Bühnen passiere, sondern auch, wer daran verdiene und wer an den mächtigen Positionen sitze. Sonja Eismann verweist dafür auf die MaLisa Stiftung, die für ihre Recherche „Gender in Music–Charts, Werke und Festivalbühnen“ der Frage nachgegangen ist: Wer schreibt, komponiert und produziert Songs? Oder genauer: „Wer bekommt eigentlich das Geld von Verwertungsgesellschaften wie der GEMA? Wie ist die Geschlechter- verteilung in den Charts?“ Die Ergebnisse zeichnen nicht das Bild eines neuen Pop- Matriarchats: „Musik in den deutschen Wochencharts wird zu mehr als 85 % von Männern komponiert. Bei der Zahl der GEMA-Mitglieder konnte ein geringer An- stieg des Frauenanteils um 1% verzeichnet werden (seit 2010, Anm. d. Autorin).“ Entsprechend schließt die Stiftung, dass es nach wie vor „eine deutliche Schieflage bezüglich der Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche“ gibt.
Autorin und Musikindustrie-Profes- sional Rike van Kleef hat eine Studie
zum selben Thema durchgeführt. Der Titel: „Wer gibt hier den Ton an? Über die Repräsentanz von Geschlecht auf deutschen Unterhaltungsmusik-Festivalbühnen“.
Die Ergebnisse hat sie in ihrem demnächst erscheinenden Buch zusammengefasst (Ventil Verlag, 2025). Im Rahmen der Recherche hat sie festgestellt, dass „es auf jeden Fall nach wie vor eine genderbasierte Ungleichbehandlung in der Musik-branche“ gibt. Diese äußere sich je Arbeitsfeld unterschiedlich, Techniker:innen werde die Kompetenz abgesprochen, Musiker:innen, dass sie ihre eigenen Instrumente stimmen könnten. Rike van Kleef betont, dass diese Diskriminierung jegliche FLINTA* und auch queere Menschen betrifft. Außerdem fand sie ein Ungleichgewicht bei den Honoraren: Ob hinter oder auf der Bühne – cis Männer werden immer noch besser bezahlt als alle anderen.
Wer jetzt einwerfen möchte, dass Musik von Männern nun mal beliebter ist und deshalb in den Charts und in Festival- Line-ups landet, Angebot und Nachfrage quasi, hat keine Fantasie. Marketing- maßnahmen bestimmen, wie präsent ein:e Musiker:in ist. Budgets für Touren, für Promotion und für Werbedeals bestimmen, wie und wo Musiker:innen platziert wer- den, welche Möglichkeiten sie bekommen. Das Publikum entscheidet natürlich selbst, was es hören oder sehen möchte. Die Entscheidung, was dabei in welchem Maße präsent ist, treffen aber andere.
Diese Entscheidungen treffen immer noch hauptsächlich Männer, die an
den machtvollsten Positionen sitzen, und offenbar entscheiden sie dabei auf frag- würdiger Basis. Es wird davon ausgegangen, dass weibliche Stars grundsätzlich weniger lukrativ sind als männliche. Denn: „Was ein Mann sagt oder singt, gilt als universelle Wahrheit, Frauen sprechen und singen nur für andere Frauen“, erklärt Sonja Eismann die Logik dahinter. Das gelte nicht nur in der Musik, sondern ebenso für Kunst und Literatur. Die zugrundeliegende Annahme existiert und wirkt auch um- gekehrt. In ihrem Buch „Gender, Branding, and the Modern Music Industry“ stellte die US-amerikanische Wissenschaftlerin Kristin Lieb, die zu Musikmarketing und -branding forscht, schon 2013 fest: Bei Frauen wird davon ausgegangen, dass sie stets ungefiltert nur über sich selbst singen. Männern wird mehr Abstraktion zugetraut – ihre Songs können, müssen aber nicht auf subjektiven Erfahrungen beruhen. Die Song-Aussagen werden deshalb auch nicht automatisch auf sie
als Personen bezogen.
„Wenn davon ausgegangen wird, dass nur die Hälfte der Menschheit sich mit dem Popsong einer Frau identifiziert, anders als bei Songs von Männern, dann ist man natürlich überrascht, wenn dieser weibliche Star Milliarden macht“, sagt Sonja Eismann. Entsprechend wird in Artikeln ständig thematisiert, wie finanziell erfolgreich und was für eine gute Geschäftsfrau Taylor Swift ist. Der Fokus aufs Finanzielle ist aber nicht nur dem Über- raschungseffekt geschuldet, sondern wird gerne auch genutzt, um darüber aufzuklären, dass sie angeblich nicht so authentisch und nahbar ist, wie sie sich stets gibt. Der Vorwurf: Taylor Swift verkauft sich als das süße Mädchen von nebenan, als die beste Freundin, als Versteherin zahlloser Teenager, aber eigentlich, Leute, eigentlich will sie nur Geld machen! Skandal. Eine Musikerin möchte mit ihrer Musik Geld verdienen. Ein international agierender Star möchte sein Vermögen vermehren und hat aus seinem Image ein gut laufendes Imperium gemacht – also genau das erfüllt, was die Musikbranche seit Jahrzehnten tut und fördert. Das kann man scheiße finden. Sehr sogar. Ich bin für jede Kapi- talismuskritik zu haben. Das relativ neue Prinzip „Kaufen, um kaufen zu dürfen“ etwa, bei dem Fans durch den Erwerb von Merch überhaupt erst die Chance bekommen, Konzerttickets zu ergattern, halte ich für zumindest ein bisschen kriminell. Und Taylor Swift ist durchaus daran beteiligt, dass die Prinzipien der Gewinnmaximierung in der Musikbranche neue Höhen erreichen.
Die Praxis der Gewinnmaximierung vor allem oder nur bei Taylor Swift zu kritisieren, greift aber wahnsinnig kurz und blendet ein paar Fakten aus. Bei großen Bands und Musikern – eigentlich kann man jeden Act eintragen, der einigermaßen nachhaltig als Musiker agiert, von Metallica und Foo Fighters über Bruce Springsteen und Harry Styles bis The 1975 –, handelt es sich um gut laufende Unternehmen, bei denen knallhart kalkuliert wird. Das hört man als Fan ungerne, weil einen die Musik des Stars berührt, die Kunst einem bedeutsam vorkommt. Man möchte als Fan nicht derjenige sein, der seinen Helden den nächsten Porsche finanziert. Aber wahr ist und bleibt, dass die Musikbranche wie jeder andere Wirtschaftszweig daran interessiert ist, Gewinne einzufahren – und das muss den Impact der Kunst nicht schmälern. Es wird eben nur bei Frauen thematisiert und/oder kritisiert, weil es in den Augen der breiten Öffentlichkeit immer noch eine Besonderheit, eine Anomalie ist.
Dasselbe gilt dafür, wie über das Aussehen von Frauen auf Bühnen und in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Jens Balzer weist im Gespräch darauf hin, dass es im Pop immer auch um das Äußere ging. Musiker:innen haben sich auf bestimmte, oft besonders markante Art und Weise gestylt und als Journalist:in hat man genau das auch schon immer thema- tisiert. Nur: Als Jon Bon Jovi in den 1980er Jahren mit tiefem Ausschnitt, hervorquellendem Brusthaar und penisfokussierenden Leggings auf der Bühne stand, wurde das wahlweise belächelt oder gefeiert. Auf jeden Fall leitete man aus seiner Sexiness nicht ab, er müsse dumm sein. Der Einsatz seiner Reize schmälerte nicht seine Fähig- keiten oder sein Ansehen. Das, worum es mir in diesem Text geht, sind die Rezeptionslogiken, denen Frauen unterworfen sind. Mit denen sie bewertet, kritisiert, geshamt werden. Frauen sind zu gierig, zu geil auf Aufmerksamkeit und Geld, zu nackt, zu angezogen, zu dumm, zu schlau, zu raffiniert. Wie über Frauen geschrieben und gesprochen wird, ist ein Seismograf dafür, wie sie betrachtet 107 werden, wie ihre Stellung ist – jenseits aller Bühnen. Medien und Musikjournalismus können dabei wegweisend sein bzw. sind immer noch Gatekeeper, auch wenn ihre Stellung längst nicht mehr so bedeutsam ist wie noch vor einigen Jahren. Neben diesem Potenzial haben (Musik-)Medien auch Verantwortung und diese sollte ernst genommen werden. „Im besten Fall weisen
Texte über Popkultur über sich hinaus“, sagt Sonja Eismann. Recht hat sie: Wie Popmusik selbst sind auch die dazugehörigen Medien schneller und einfacher am
Puls der Zeit als andere Disziplinen. Sie können schneller reagieren, Zusammen- hänge feststellen und Missstände identifizieren und uns die Gegenwart erklären.
Sie würde sich wünschen, dass Stereotype nicht mehr einfach nur reproduziert werden, so Sonja Eismann. Das bedeutet nicht, dass Musik oder Produkte von
Frauen nicht kritisiert werden dürfen. Ein guter Verriss muss aber eben fair sein
und fundiert, was – wenn es richtig gemacht wird – weit mehr Auseinandersetzung mit der Kunst erfordert als eine Lobeshymne oder eine Polemik. Und auch Leser:innen müssen sich daran gewöhnen, dass die erfolgreiche Frau nicht direkt abgestraft gehört, weil sie es wagt, Forderungen zu stellen, in den Vordergrund zu treten, Geld machen und Macht ausüben zu wollen. Sie gehört ernst genommen.
Oder wie Taylor Swift es zusammenfasst:
"And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, I'd be the man."